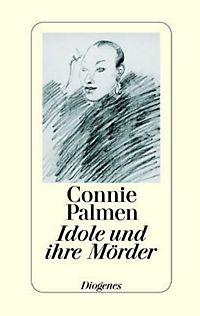Ein Buch über Homer und über Gewalt und über Zivilisation. Ungeheuer faszinierend und ebenso schrecklich in seiner kompromisslosen Benennung der Gewaltdarstellungen in Homer als brutale Gewalt.
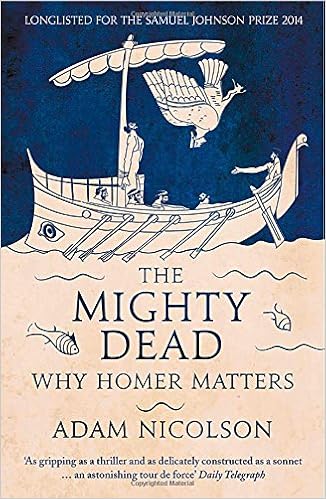
„The Mighty Dead“ ist unkompliziert zugänglich; sein Autor nutzt Stilmerkmale aus Reisebericht, historischer Forschung und formuliert außerdem einen leidenschaftlichen Appell an die Macht der Poesie.
Das Buch verfolgt zwei unterschiedliche inhaltliche Ziele:
- Wie kam es zu den Texten, die wir heute als „Ilias“ und als „Odyssee“ kennen?
- Wovon handeln diese Texte? Was sagen sie uns?
Wie sind die Texte der „Ilias“ und der „Odyssee“ entstanden?
Adam Nicolson, Enkel von Vita Sackville-West, beschreibt in seinem Buch, wie europäische Heldenlieder aus unterschiedlichsten regionalen Gebieten für Jahrhunderte mündlich überliefert wurden. Die Sänger, die diese Lieder sangen, waren alle seiner Auffassung nach ein Teil dessen, was wir heute „Homer“ nennen. Die ältesten Teile gehen dabei vermutlich auf die Zeit von 1800 v. Chr. zurück.
Ca. 280 v.Chr. wurden in der Bibliothek von Alexandria Texte erstellt, die sich aus den unterschiedlichen, damals überlieferten Quellen – mündliche Überlieferungen und Papyri – speisten. Schon diese Texte von „Ilias“ und „Odyssee“ weisen Glättungen, Vereinheitlichungen, stilistische Veränderungen auf, so wie sie in der Übersetzungsgeschichte beider antiker Texte immer wieder vorkommen sollten: „Homer“ sollte einfach nicht „primitiv“ sein. Nicolson belegt diese These gut anhand linguistischer Details und durch die Übersetzungsgeschichte.

„He (Homer) sang of the past (…): as the violence and sense of strangeness of about 1800 BC recollected in the tranquillity of about 1300 BC, preserved through the Greek Dark Ages, and written down (if not in a final form) in about 700 BC. Homer reeks of long use.“
Wovon handeln „Ilias“ und „Odyssee“?
Funktion der Helden-Gesänge war es, den individuellen Ruhm vor der Vergänglichkeit zu retten. Die Heldentat, der heldenhafte Tod haben nur einen Sinn, wenn sie die Zeit überdauern, wenn sich jemand an sie erinnert. Das immer wieder gesungene, von Generation zu Generation tradierte Lied selbst ist deshalb, laut Nicolson, der Garant für den Ruhm der homerischen Helden. Hierbei reichen Inhalte „Homers“ weit zurück bis in die Bronzezeit: „In his Greek heroes, Homer gives voice to that northern warrior world. Homer is the only place you can hear the Bronze Age warriors of northern grasslands speak and dream and weep. The rest of Bronze Age Europe is silent. Echoes of what was said and sung in Ireland or in German forests can be recovered from tales and poems collected by modern ethnographers, but only in Homer is the connection direct.“
Homerische Gesänge haben den Konflikt „Stadt“ gegen „Gang“ zum Thema, Zivilisation gegen Barbaren. Sie beschreiben den Konflikt zwischen einer städtischen, durch Handel geprägten Zivilisation rund um das Mittelmeer mit einer von Norden kommenden Gruppe von Menschen, die teil-nomadisch lebte und die kriegerische Auseinandersetzung im Zentrum ihres Lebens sah.
Sehr überzeugend finde ich den Vergleich zu modernen Gang-Werten, den Nicolson zieht. Dieser erinnert mich an die Formulierung Christa Wolffs „Achill, das Vieh“ (Kassandra): Für die „Gang“ zählen Ehre, körperliche Überlegenheit, Tötung des Opponenten als identitätsstiftende Attribute.






![La ciudad de los prodigios de [Garrriga, Eduardo Mendoza]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41zrOGicTtL.jpg)