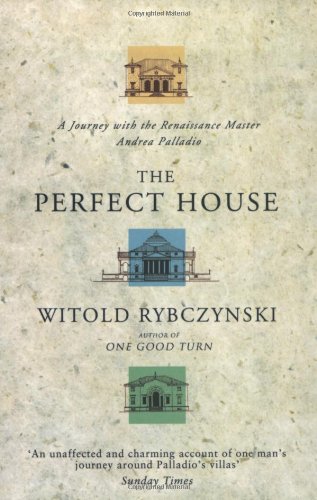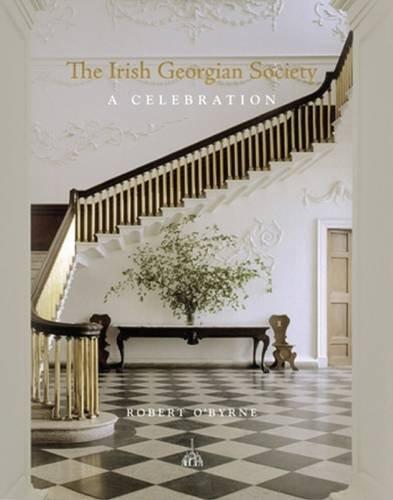Wieder ein Beitrag aus der Serie obskurer Werke aus Irland. Irgendwann vor 1400 entstand in Irland eine der frühesten Adaptionen der Aeneis von Vergil in eine einheimische Sprache überhaupt. „Übersetzung“ wäre falsch, denn die Aeneis, auf Irisch „Imtheachta Aeniasa“ oder die „Fahrten des Aeneas“, wurde tatsächlich ver-irisch-t.

Aufgeschrieben ist dieses Werk im sogenannten Book of Ballymote, in dem sich auch andere klassische Werke in irischer Verkleidung wiederfinden, unter anderem eine äußerst faszinierende, ebenfalls sehr irische Version der Odyssee.
Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die dieses Werk sehr interessant machen. Da ist zunächst wie erwähnt der sehr frühe Zeitpunkt der Adaption irgendwann im 14. Jahrhundert. Obwohl Dichtung in Irland weit verbreitet und gut etabliert war, wählte der Verfasser keine irischen Hexameter, sondern eine Prosaübertragung, eventuell um einen historisch-faktischen Charakter der Aeneis zu betonen.
Vor allem aber sticht die „Irisierung“ hervor.
Ein Keltologe, Edgar Slotkin, hat die Verfahrensweise des Verfassers so beschrieben: „His concern was not so much a translation from one language to another but from one culture to another (…) The Irish Aeneid is periphrastic. Words are not fixed, but nothing essential is omitted. (…) The substantial additions the translator made to the original are (…) not new themes or content, but native elaborations on content which he encountered there.“ Ein anderer Keltologe, Erich Poppe, beschreibt die irische Aeneis „as the product of the fusion of a developed vernacular stylistic and narrative tradition with a learned and historiographical interest in events of classical antiquity. (…) Imtheachta Aeniasa can tell its modern readers much about the mentality and interests of its medieval Irish audience, precisely because it departs characteristically from its source.“
Sprachlich macht sich die Irisierung dadurch bemerkbar, dass der Verfasser in bestem irischen Sagenstil schreibt: Die Vergil’schen Epitheta und Vergleiche verschwinden. Statt dessen finden sich viele Alliterationen und Aneinanderreihungen von wohlklingenden Synonymen. Auch gibt es die für irische Sagen typischen, etwas barock und floral anmutenden Beschreibungen von handelnden Personen.
Hierfür lohnt es sich, einige Beispiele zu geben.
Für die Beschreibung eines aussichtslosen Plans:
„is lam a nead nathrach, is lua fri broth & lem chind fri hall“,
auf Englisch: „it is a hand in a nest of serpents, it is a kick against goads and a dash of a head upon a rock“
Für Alliterationen bei der Beschreibung von Personen:
„Ba suairc sochraidh sognimach saerchlanda socheniuil in ingen sain“,
auf Englisch: „That daughter was gentle, of beautiful form and good actions, free-born and noble.“
Und für eine längere Passage eine Beschreibung von Aeneas bei seiner ersten Begegnung mit Dido, nur in Englisch, wobei manche englische Worte etwas unpassend wirken – hierfür kann aber das irische Original nichts:
„Pleasant, comely, lovely, and well-born was the hero that came there – fair, yellow, golden hair upon him; a beautiful ruddy face he had; eyes deep-set, lustrous in his head like an image of a god, the expression which Venus, his mother, with love’s splendour, threw into his face, so that whoever looked upon him should love him.“
Gelesen habe ich die 1907 erstmals erschienene irisch-englische Ausgabe von George Calder, die recht gut als Nachdruck zu bekommen ist. Interessant ist der Text allemal. Sonst hätte ein anderer irischer Dichter, Seamus Heaney, nicht auch eine Übersetzung der Aeneis versucht.
![How Architecture Works: A Humanist's Toolkit von [Rybczynski, Witold]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51QfRCtEPGL.jpg)