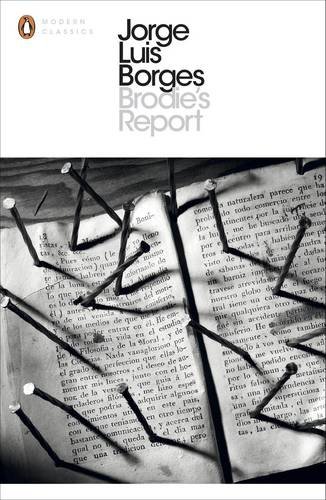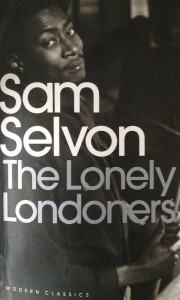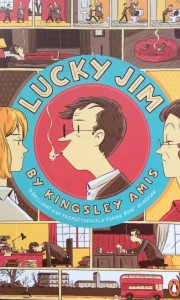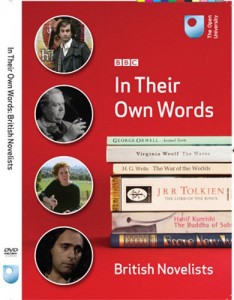Mir war bisher gar nicht aufgefallen, dass Brian Sewell, ein 2015 verstorbener englischer Kunsthistoriker, äußere Ähnlichkeiten mit Loriot hat.

Darum geht es hier aber nicht.
Brian Sewell, enfant terrible der englischen Kunstkritik und Schrecken aller Promotoren zeitgenössischer Kunst, hat eine Autobiographie geschrieben, die in zwei Bänden erschienen ist und deren ersten Teil ich gerade gelesen habe. Der Untertitel passt ausgezeichnet: „Always almost, never quite“.

Am Einband lag es nicht, dass ich dieses Buch gekauft habe. Entscheidend war, dass ich ausgezeichnete und in jeder Hinsicht idiosynkratische DVDs mit/von ihm gesehen habe, insbesondere die Reihe über die „Grand Tour“, und auch etliche seiner Kunstkritiken in diesem Blog besprochen habe. Für all diejenigen, die gut gesprochenes Englisch mögen, ist er auch ein akustisch-ästhetischer Gewinn. Ein Kommentator des Guardian beschreibt es so: „(…) he sounds, as I duly noted, like a dowager duchess carefully recalling a large turd she was once mistakenly served during tea at Claridge’s.“

Soviel zum Drumherum.
Der erste Band umfasst die Zeit von seiner Geburt 1931 bis zu seinem Ausstieg bei Christie’s 1967. Der Klappentext gibt eine recht gute Zusammenfassung: „Outsider is the life of a child, boy, adolescent, student and young man in London between the Great Depression of the 30s and the sudden prosperity and social changes of the 60s, affected by the moral attitudes of the day, by the Blitz, post-war austerity and the new freedoms of the later 50s that were resisted with such obstinacy by the old regime. It is about education in the almost forgotten sense of the pursuit of learning for its own sake. It is about the imposed experiences of school and National Service and the chosen experience of being a student at the Courtauld Institute under Johannes Wilde and Anthony Blunt. It is about sex, pre-pubertal, in adolescence and in early adulthood, and the price to be paid for it. It is about art and the art market in the turbulent years of its change from the pursuit of well-connected gentleman to the professional occupation of experts.“
So etwas wie diese Autobiographie habe ich noch nicht gelesen. Was für ein unmittelbares, direktes, ungeschöntes und vorbehaltloses Panorama der Zeit! Was für ein Selbstbewusstsein, sich selbst so ins Auge zu sehen und das Gesehene und Erlebte aufzuschreiben. Den Anspruch, den er als Kunsthistoriker und -kritiker hatte, wendet er auch auf seine Memoiren an: „(…) if I did not tell the whole truth it would not be truth at all. (…) approaching my eightieth year and old enough to be neither embarrassed nor ashamed, I no longer feel the need for reticence.“
Seine Erfahrungen im Courtauld-Institut und bei Christie’s sind faszinierend und bringen einen ins Grübeln. „Macht und Mensch“ ist immer wieder eine ungünstige Kombination, auch in der scheinbar erhabenen und zivilisierten Arena der Hochkultur, zumal wenn sie durch grundsätzliche Interessenkonflikte noch virulenter gemacht wird.
Seine Ausflüge ins sehr Private sind bestimmt nichts für jeden Leser. Dessen war sich Sewell bewusst:
„I have dug deep into indiscretion and some may say that I have dug deeper into prurience; perhaps I have, but again it is for the benefit of readers who are troubled by their private natures and feel that they alone are driven so. I have no doubt that many who admire me – my ‚doting elderlies‘, as an old woman friend once dubbed them – will be disgusted. So be it – truth is nothing if not whole.“
Der Guardian hat aber für mich recht, wenn er in seiner – auch sonst sehr lesenswerten – Rezension schreibt: „Outsider is a delicious read.“