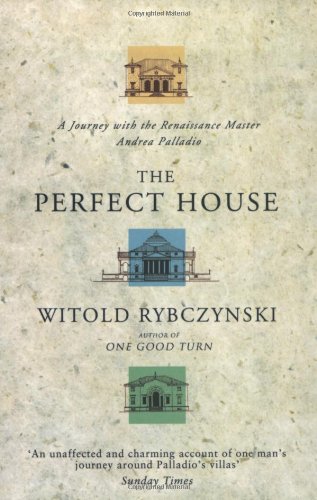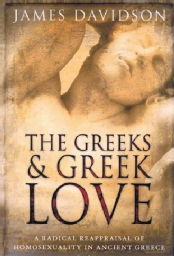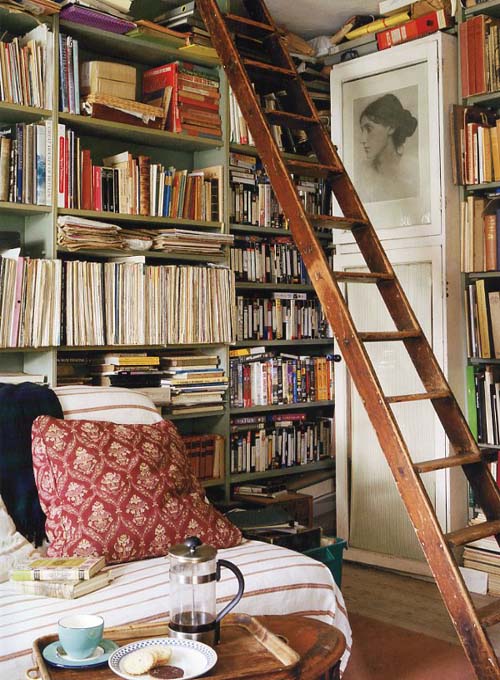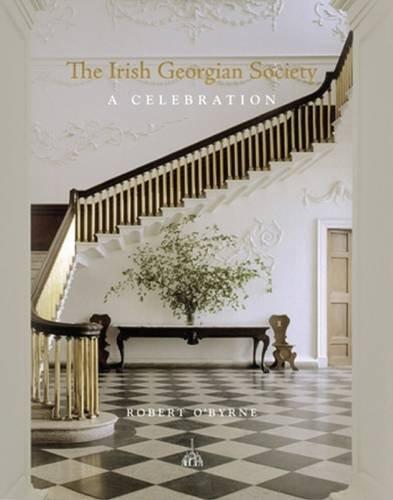Kölner Lokalpatriotismus ist heute an der Reihe. Angedroht hatte ich ihn unauffällig schon an anderer Stelle. Thema also: Ein Hauptwerk von Johannes Duns Scotus, seine „Abhandlung über das erste Prinzip“, auf Latein „Tractatus de primo principio“.
Johannes Duns Scotus lebte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Geboren in Schottland wurde er Franziskaner, starb mit etwa 40 Jahren und fand seine letzte Ruhestätte in Köln. Simple Quizfrage also für Kölner und Franziskaner: In welcher Kirche befindet sich sein Grabmal? Natürlich in der Minoritenkirche!

Leicht hatte er es also nicht immer, der Duns Scotus…
Andererseits hat er es seinen Lesern auch nicht leicht gemacht. Nicht nur sind seine Werke wegen der wohl auch für ihn überraschenden Kürze seines Lebens alle unvollständig und unfertig geblieben. Auch sollte man Logik, Metaphysik und Scholastik schon mögen, um jede Feinheit richtig goutieren zu können.

Für Einsteiger beschränke ich mich in Anbetracht der Außentemperaturen von aktuell über 30° auf zwei Aspekte. Der eine wird Unternehmensberater vor allem von McKinsey und deren Kunden interessieren. Der andere ist von allgemeinem Interesse und kann auch beim Hühnchen-Grillen im Freundes- und Familienkreis bedenkenlos zum Besten gegeben werden.
Wer McKinsey kennt, kennt MECE: „mutually exclusive, collectively exhaustive“. Das braucht man, um komplexe Themen trennscharf und vollständig in ihre Bestandteile zu zerlegen, die man dann anschließend der Reihe nach bearbeitet. Duns Scotus hat das zwar nur von Aristoteles gelernt, aber prägnant formuliert:
„Manifestatio vero divisionis tot requirit: primo, ut dividentia notificentur et sic ostendantur contineri sub diviso; secundo, ut dividentium repugnantia declaretur; et tertio, ut probetur dividentia evacuare divisum.“
Man merkt schon hier: Duns Scotus hat drei Kriterien, McKinsey nur zwei – da ist den Kollegen die Unterteilung nicht vollständig gelungen, also nicht MECE…
Auf deutsch in der Übersetzung von Wolfgang Kluxen (dessen Ausgabe ich – allerdings nur in Teilen – gelesen habe), die allerdings weniger klar ist als das Original:
„Die Darlegung einer Einteilung erfordert nun folgendes: Erstens, die Einteilungsglieder sind (begrifflich) zu bestimmen und von daher ist zu zeigen, daß sie im Eingeteilten enthalten sind; zweitens, es ist darzutun, daß die Einteilungsglieder sich ausschließen; und drittens, es ist nachzuweisen, daß die Einteilungsglieder das Eingeteilte ausschöpfen.“
Jetzt zum allgemein Interessanten: Was war zuerst, die Henne oder das Ei?
Als Scholastiker kann man diese Frage tatsächlich schlüssig beantworten, und zwar unabhängig davon, welche „ordo“, also welche Ordnung man verwendet, die des Vorranges oder die der Abhängigkeit (für die Grillparty: „ordo eminentiae“ oder ordo dependentiae“). Nach der Ordnung des Vorranges kommt die Henne zuerst, denn „was immer dem Wesen nach vollkommener und vorzüglicher ist, ist in diesem Sinne früher.“ Nach der Ordnung der Abhängigkeit gewinnt ebenfalls die Henne, denn ohne Henne wird aus dem Ei kein Huhn schlüpfen (zumindest nicht im relevanten Damals, als es noch keine Brutautomaten gab): Das Ei ist vom Huhn abhängig, nicht umgekehrt. Auf scholastisch:
„Prius secundum naturam et essentiam est quod contingit esse sine posteriori, non e converso.“ Oder: „Der Natur und dem Wesen nach früher ist, was wohl ohne das Spätere sein kann, nicht aber umgekehrt.“
So dass wir das jetzt auch endlich geklärt haben.





 Hier eine
Hier eine