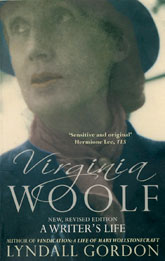Ein wunderbares Buch über die 20er Jahre! Klug, wissensreich, spannend, anrührend und – all dies und außerdem auf eine ungewöhnliche Weise erzählt.

Ein Flapper ist das englische Äquivalent der Garsonne: „Flappers were a generation of young Western women in the 1920s who wore short skirts, bobbed their hair, listened to jazz, and flaunted their disdain for what was then considered acceptable behavior. Flappers were seen as brash for wearing excessive makeup, drinking, treating sex in a casual manner, smoking, driving automobiles, and otherwise flouting social and sexual norms. Flappers had their origins in the liberal period of the Roaring Twenties, the social, political turbulence and increased transatlantic cultural exchange that followed the end of World War I, as well as the export of American jazz culture to Europe.“ So Wikipedia.



Mackrell stellt dieses sechs Frauen in den Mittelpunkt ihres Buchs: Diana Cooper, Nancy Cunard, Tamara de Lempicka, Tallulah Bankhead (hier Eindrücke aus Movie Legends), Zelda Fitzgerald und Josephine Baker (Tanz-Video). Für sie alle waren die Zwanziger eine Zeit außergewöhnlicher individueller Entwicklungsmöglichkeiten. Als eine Gruppe von Frauen sind sie repräsentativ für ihre Zeit. Sie waren ambitioniert, waren (zeitweise) äußerst erfolgreich, lebten einen Teil ihres Lebens in Paris und genossen einen hohen Bekanntheitsgrad.
Über diese sechs Frauen schrieben bereits zu Lebzeiten Buchautoren und Journalisten, Fotografen, Filmemacher und Bildhauer machten ihre Gesichter bekannt. So wurden sie zu Vorbildern und Rollenmodellen für Tausende von jungen Frauen: „All these women lived many of their private moments on the public stage. Having made their names as writers, painters or performers, as well as popular celebrities, the things they said and did, the clothes they wore, were routinely reported in the press and had a widespread impact on other women. Yet stylish, talented and extraordinary as these six were, to imagine their lives now one has to look past the glamour and glare of their fame.“

Möglich wurde dieser große Bekanntheitsgrad erst durch das sich schnell verbreitende Kino und die Werbung, die sich zum ersten Mal an eine große Zahl junger Frauen mit eigenem Einkommen richtete. Die Erzählform des Buchs besteht in sechs Kurzbiografien, die erklären, wie es sechs junge Frauen geschaft haben, ungewöhnliche Entscheidungen zu treffen. Danach kommen wieder sechs Kurzbiografien, die zeigen, wie ihr Leben weiterging. Eine Auswahl aus den vielen Faken, die die Autorin wie nebenbei für ein besseres Verständnis der Zeit mitliefert:
- Morphium wurde als Stärkungs- und Beruhigungsmittel zunächst während des 1. Weltkriegs den Soldaten an der Front geschickt. Wie ein Medikament wurde es dann auch von zivilen Personen genutzt.
- Haschisch wurde in den 20ern als Party-Droge oft in Kugelform verwendet und in Cocktails aufgelöst.
- Cocktails wurden in New York täglich neu erfunden, um durch ihre intensiv schmeckenden Zutaten den unangenehmen Geschmack des schwarz-gebrannten Alkohols zu überdecken. Es herrschte ja Prohibition.
Und nach den Goldenen Zwanzigern? „This book ends on the cusp of the old and the new decade. It was the point at which the experimental party spirit of the Twenties was coming into collision with economic crisis, with the extreme politics of communism and fascism and the gathering clouds of war. And just as this moment heralded the the winding down of the jazz age, so too it marked the end of the flapper era.“
Einfach toll und sehr lesenswert!

![Mutter Teresa: Die wunderbaren Geschichten von [Maasburg, Leo]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/516Ik2%2Bgh0L.jpg)



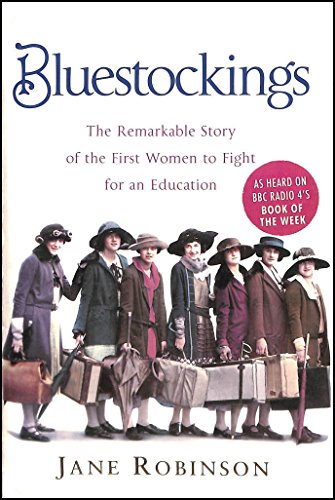






![How Architecture Works: A Humanist's Toolkit von [Rybczynski, Witold]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51QfRCtEPGL.jpg)