The unexpected professor war ein unerwartetes Vergnügen. Die Autobiographie von John Carey (* 1934), emeritierter Englisch-Professor und Fellow des Merton College, ist in vielerlei Hinsicht ein klassisches Beispiel der Kategorie „Autobiographie eines Oxford-Professors“, aus anderem Blickwinkel betrachtet jedoch fällt sie vollständig aus dem Rahmen.
Wie die meisten Autobiographien beginnt The unexpected professor mit Geburt und Kindheit und arbeitet sich chronologisch voran. Nur Ereignisse, Dinge, Menschen mit Relevanz für die Person des Autoren werden erwähnt. Alle Wertungen, Schwerpunkte, Auslassungen sind subjektiv seine eigenen. Auch die typischen Charakteristika einer Oxford-Professoren-Geschichte sind vorhanden: Understatement und Ironie, eindrucksvolle College-Architektur, viel Portwein, seltsame Gebräuche, exzentrische Kollegen.

Anders ist diese Autobiographie jedoch, da sie eine ungewöhnliche Beziehung in den Mittelpunkt stellt: „something more personal – a history of English literature and me, how we met, how we got on, what came of it“. Das Wort Liebesbeziehung hierfür zu verwenden, ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
Normale biographische Details und Anekdoten werden verwendet, da sie begründen, warum Carey wann was gelesen hat und warum er Literatur so interpretiert, wie er sie interpretiert: Auch strukturieren sie seine Lese-Erfahrungen und ergeben die Kapitelfolge: „Grammar School“, „Playing at Soldiers“, „Undergraduate“…. Nicht zuletzt bringt das Biographische dem Leser auch den Menschen John Carey näher, vermittelt seine Austerität, seinen Humor, seine Komplexe, seine Liebenswürdigkeit:
„At about the same time Gill, very courageously, agreed to marry me, and share my worldly goods, which still amounted, in effect, to the Bakelite radio and the electric coffee pot. So quite early in the morning on Ascension Day, 7 May 1959, I bought a bottle of champagne from Christ Church buttery, and (we) drank to one another’s futures beside the round pond in the middle of Tom Quad, while the goldfish gleamed and the waterlilies spread their petals and Mercury, with jets of water dancing round him, stood on one leg on his plinth and pointed to the sky. It was a most un-Carey-like episode. Champagne! In the morning!“
Damit ist dieses Buch eine ganz seltsame, eigenartig faszinierende, für mich sehr einnehmende Mischung aus Lebenserfahrungen und sehr persönlicher Einführung in die englische Literatur, aus Tutorium und Beziehungsgeschichte, aus Großartigem und Bescheidenheit.
Besonders anregend ist, was Carey über einzelne Texte und Autoren (leider fast ausschließlich Männer…) sagt. So erfährt man seine – nicht nur positiven – Gedanken zu John Milton und Samuel Beckett, zu John Donne und George Orwell, zu D.H. Lawrence und Joseph Conrad. Nachvollziehbar werden seine Überlegungen durch viele exzellent gewählte, auch lange Zitate.
Mir selbst war Milton zum Beispiel bisher eher fremd, und ich fand ihn abweisend. Nicht gewusst hatte ich dabei, dass „it has been estimated that, under the Presbyterian Blasphemy Ordinance of 1648, (… he would have been) liable to five death sentences and eight terms of life imprisonment.“ Jetzt bin ich neugierig auf ihn.
Erfrischend auch seine offenen Worte zu der einen oder anderen ungenießbaren wissenschaftlichen Publikation: „A new custom (…) was for authors to preface their terrible tomes with pages of effusive thanks to all those – teachers, academic colleagues, friends, parents, partners, children, childminders, and as like as not the family dog – without whom the volume would never have come into being. I cursed them all fervently in my heart.“
Und dann ist da noch das Schlußkapitel „So, in the End, Why Read?“. Seine Gründe:
- „… reading opens your mind to alternative ways of thinking and feeling. (…)
- Book-burners try to destroy ideas that differ from their own. Reading does the opposite. It encourages doubt. (…)
- Reading distrusts certainty. (…)
- Reading punctures pomp. (…)
- Reading is contemptuous of luxury. (…)
- Reading makes you see that ordinary things are not ordinary. (…)
- Reading is vast, like the sea, but you can dip into it anywhere and be refreshed.
- Reading takes you into other minds and makes them part of your own.
- Reading releases you from the limits of yourself.
- Reading is freedom.“


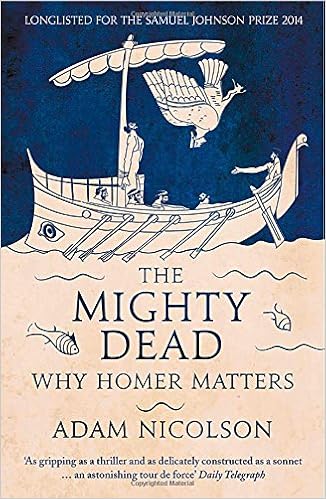






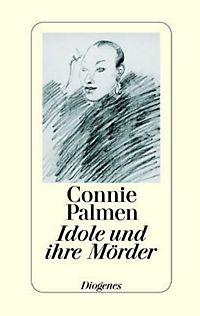






![Remember Me?: Loving and Caring for a Dog with Canine Cognitive Dysfunction by [Anderson, Eileen]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51S0TFliO5L.jpg)