Diese Sammlung von Sonetten lässt sich nicht lesen, ohne berührt, betroffen, beeindruckt und verändert zu werden. Ich habe schon einiges von Micheal O’Siadhail gelesen, aber mit solchen Gedichten habe ich nicht gerechnet. „I read slowly, carefully and with deep emotion One Crimson Thread. It is a beautiful, beautiful but terribly sad poem of love.“
150 Sonette, ein Thema: Die Liebe zwischen ihm und seiner Frau Bríd vor dem Hintergrund der letzten zwei Lebensjahre seiner Frau, die schon seit 20 Jahren an Parkinson litt, danach auch unter Demenz.

Eine solche Themenwahl kann leicht schief gehen, kann voyeuristisch werden, gefühlsduselig, peinlich. Diese Klippen umschifft O’Siadhail mit seinen vielleicht besten und bestimmt persönlichsten Gedichten. Unter diesem Link findet sich ein Video, in dem O’Siadhail eines seiner Sonette liest.
Inhaltlich kann ich die Sonette nicht besser beschreiben, als dies ein Zitat von Joseph Heininger auf der Buchrückseite tut: „(…) Michael O’Siadhail explores how a devoted husband and wife respond and adjust when she is greatly altered by Parkinson’s disease, examining his states of mind and feeling, his daily adjustments, her changing personality, and finally his sorrow and brokenness at her death. Yet at the spiritual heart of this sequence are the ways in which the poems courageously show how the couple’s deep-rooted love searches for ways to overcome her debilitating illness, their fear and dread, and their eventual loss.“
Die Sprache, so scheint mir, ist das Gerüst, das O’Siadhail beim Schreiben über seine Gefühle geholfen hat, Stabilität zu bewahren. Die Worte sind einfach, viel weniger Fremd- oder ungewöhnliche Worte als in anderen seiner Gedichtbände. Auch der Satzbau ist eher schlicht. Vorsichtig schreibt er, tastend, aber auch sehr deutlich und unmittelbar, benennt die Dinge, berührt die Stellen, an denen es wehtut.
Und voller Dichtkunst, dicht zum Beispiel an der Reim- und Assonanz-Tradition irischer und walisischer Lyrik seit dem frühen Mittelalter, dicht vielleicht auch an der Qualität von Shakespeares Sonetten. Mit ausbleibendem Reim, je weiter weg ihm seine Frau vorkommt, je mehr er kämpft und verzweifelt ist.
Eine Zeile aus Sonett 150:
„The pain of loss the price of love we pay.“



![How Architecture Works: A Humanist's Toolkit von [Rybczynski, Witold]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51QfRCtEPGL.jpg)

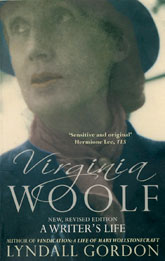









 Hier eine
Hier eine 