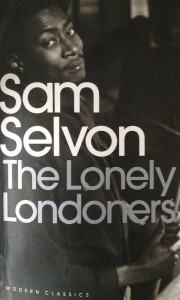Um den Eindruck zu vermeiden, eventuell zu stark auf englische oder zumindest englisch-sprachige Literatur oder gar auf eine Art „Mainstream“ ausgerichtet zu sein, heute ein Beitrag zu einem der vielleicht besten walisischen Dichter: Dafydd ap Gwilym, der im 14. Jahrhundert gelebt hat.
Immer wieder neu aufgelegt wird ein Buch, das zuerst 1982 erschienen ist und dessen immerhin 3. Auflage von 2003 ich gelesen habe. „Immerhin“, denn das Buch macht auf seinen rechten Seiten für die meisten Leser einen eher sperrigen, deutlich konsonantigen, man möchte fast sagen: abschreckenden Eindruck – auf dieser Seite steht jeweils das walisisch-sprachige Original.
Warum erfreut sich Dafydd ap Gwilym also offensichtlich einer wahrnehmbaren Popularität? Und ist seine Lyrik auch etwas für Nicht-Waliser?
Dafydd ap Gwilym ist schon besonders:
- Ungefähr zeitgleich mit Geoffrey Chaucer lebend, hat er fast im Alleingang eine Verbindung geschaffen zwischen der walisischen bardischen Tradition des frühen Mittelalters und der Troubadour- und Minnelyrik insbesondere des französischsprachigen Raums, die auch dank der Normannen in England und Wales eine Rolle gespielt hat.
- Außer dieser innovativen Weiterentwicklung hat er – auch wieder quasi im Alleingang – die eigene Person deutlich stärker ins Zentrum seiner Gedichte gerückt als in der walisischen Tradition üblich. Dies macht seine Gedichte recht zugänglich.
- Ein Innovator ist er auch, da er die walisische Sprache um zahlreiche Worte – auch um Lehnworte vom Kontinent – erweitert hat, die er als Neuschöpfung in seinen Gedichten verwendet.
- Vor allem aber ist er herausragend aufgrund seiner poetischen Meisterschaft. Die Anforderungen der walisischen Poetik zur Form von Strophe und Vers, Silbenzahl, Reimformen, Alliterationen, anderen Lautharmonien sind so vielfältig, dass es fast ein Wunder ist, hierbei auch noch inhaltlich zu glänzen. Und dies tut Dafydd ap Gwilym.
Für all diejenigen, die mit Walisisch nichts anfangen können, geht aber leider viel verloren. Denn gerade walisische Dichtung beeindruckt (und soll beeindrucken) viel stärker durch ihre akustische Wirkung als durch die Inhalte. Und die akustische Ästhetik lässt sich auch vom besten Übersetzer nicht einmal ansatzweise nachschaffen.
Bromwich als Übersetzerin und Herausgeberin dieses Buchs tut viel, um die Lücke zum Walisischen zu überbrücken. Ihre Einleitung bringt einem den Dichter, die walisische Bardentradition und auch die poetischen Anforderungen näher. Die Anmerkungen zu den Gedichten sind umfassend und erleichtern das Verständnis. Schade vielleicht, dass die Übersetzungen doch eher auf den inhaltlichen Sinn fokussieren, als dass sie hohe poetische Anforderungen erfüllen wollen. Persönlich wäre mir eine andere Balance lieber gewesen.
Das Buch ist sicherlich nichts für jeden Leser. Aber für alle, die sich mit mittelalterlicher Lyrik befassen, ist es ein Gewinn. Und für Freunde keltische oder speziell walisischer Literatur und Kultur sowieso.
Als Leseprobe der Auszug eines der bekanntesten Gedichte von Dafydd ap Gwilym, in dem er Naturdichtung – über den Wind – mit Liebesdichtung – der Wind als Liebesbote an seine Geliebte Morfudd – miteinander verbindet:
„Yr wybrwynt helynt hylaw
Agwrdd drwst a gerdda draw,
Gŵr eres wyd garw ei sain,
Drud byd heb droed heb adain. „
Bromwich übersetzt:
„Sky wind of impetuous course
who travels yonder with your mighty shout,
you are a strange being, with a blustering voice,
most reckless in the world, though without foot or wing.“
Eine etwas poetischere Übersetzung des Gedichts von Gwyneth Lewis, durchaus dichter hinsichtlich der Klangeffekte am Original, findet sich hier auf der Website der Poetry Foundation.
Und wer es genau wissen will, kann sich auch den walisischen Originalton anhören (man muss dann noch Gedicht 47 „Y Gwynt“ aussuchen und anschließend auf Audio klicken), da das Welsh Department der University of Swansea eine ganze Website den Gedichten von Dafydd ap Gwilym gewidmet hat.