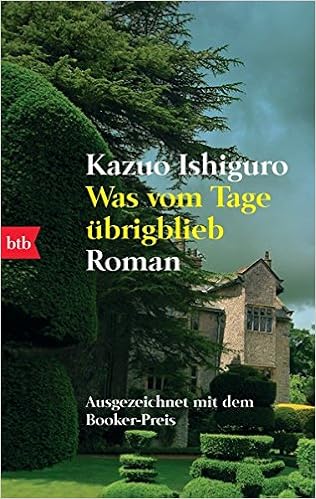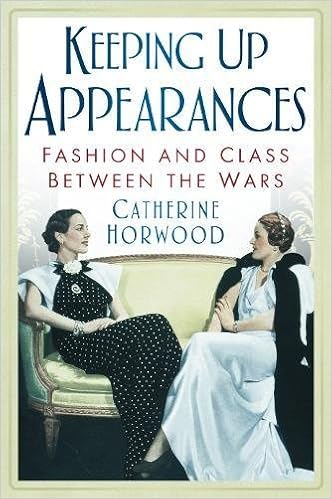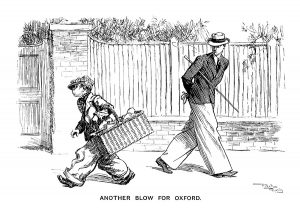Poor People ist ein Buch über die Armut in der Welt, welches arme Menschen und deren Leben in den Mittelpunkt stellt.

Poor People – eine Reise um die Welt
Vollmann reist zu Elendsvierteln der Welt nach Thailand, in den Jemen, in die USA, nach Kolumbien, nach Vietnam, Afghanistan, nach Russland, China und Japan… Er stellt den „armen“ Menschen, die er trifft, ein paar einfache Fragen:
- „Sind Sie arm oder reich?“
- „Warum sind manche Menschen arm, andere reich?“
- „Wer ist Schuld daran?“
Die Antworten sind alles andere als einfach, die Begründungen ebenso wenig. Einige der Interviewten bezeichnen sich als reich. Viele geben als Gründe für ihre Lage an: eigene Schuld, ein einschneidendes äußeres Ereignis, das Schicksal. Vollmann erfragt in seinen Gesprächen, für die er seine Gesprächspartner und -partnerinnen bezahlt, deren Lebensgeschichten. In diesen Porträts zeigt er Behutsamkeit und Respekt. Auch hierbei macht er es sich selbst nicht leicht: Nie vergisst er die Tatsache, ein reicher Mann zu sein, der einen weniger vermögenden Menschen befragt und die Antworten mit Geld bezahlt. Keine vorgefertigte Meinung zu haben, keine einfachen Lösungen parat zu haben und die eigene Perspektive immer wieder kritisch zu hinterfragen, das macht den Autor und sein Buch „Poor People“ zu etwas Besonderem.

Was ist Armut?
Laut „Handbook of Income Distribution, 2000“ sind Statistiken über Armut nicht immer hilfreich: Je nach Veröffentlichung stieg die Armut in Irland stark an, ein wenig, veränderte sich nicht oder sank… Obwohl die gleichen Daten aus zwei Jahren verwendet wurden. Die Kurzdefinition der UN zeigt Pragmatismus, berücksichtigt jedoch nur die materielle Seite der Armut: „Poverty is an income of less than four dollars a day.“ Vollmann versucht dagegen, auch die nicht-materiellen Seiten der Armut in den Blick zu nehmen: „Poverty is wretched subnormality of opportunity and circumstances.“ Am intensivsten setzt er sich mit einer Definition Adam Smith´auseinander: „Every man is rich or poor, to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries, conveniencies, and amusements of human life. But after division of labour has once thoroughly taken place, it is but a small part of these which a man´s own labour can supply him.“
Erscheinungen der Armut
Im Kapitel „Phenomena“ zeichnet Vollmann ein Bild der verschiedenen Erscheinungsformen und Begleiterscheinungen von Armut. Er beschäftigt sich mit:
- Invisibility
- Deformity
- Unwantedness
- Dependance
- Accident-prone-ness
- Pain
- Numbness
- Estrangement
Ganz und gar ungewöhnlich ist Vollmanns Haltung, Menschen nicht zu verurteilen, die Alkohol, Drogen, Verdrängung nutzen, um ihren Alltag zu bewältigen. Er versucht, deren Verhalten zu respektieren: „You (Leser/Leserin) are rich, so tell me: Who does make you? What would they have been had poverty not diminished them? Would they be any happier? (…) Who would Sunee be were she not an illiterate, self-hating, furiously resigned drunk? In any event, the darkness of her incompletion, such as it is, may approximate the darkness of my own blindness.“
Bilder von Menschen
Der hintere Teil von „Poor People“ enthält schwarz-weiß Fotografien der Menschen, die der Autor getroffen und gesprochen hat. Die meisten diese Bilder sind Porträts, in denen die Fotografierten die Betrachtenden direkt anschauen.
Der Autor William T. Vollmann
Vollmann ist ein US-Autor und Journalist, der regelmäßig Krisengebiete bereist und seine Erfahrungen literarisch verarbeitet. Zum Beispiel in „An Afghanistan Picture Show, or, How I Saved the World“. Anfang 2004 erschien „Rising Up and Rising Down“, eine 3.300 Seiten lange, siebenbändige, illustrierte Abhandlung über Gewalt. Vollmann hat daran über 20 Jahre lang gearbeitet und versucht, umfassend die Ursachen und Folgen von Gewalt zu untersuchen sowie die mit ihr verbundenen ethischen Fragen. Ein großer Teil des Textes besteht aus Vollmanns eigenen Reportagen über Orte voller Gewalt wie Kambodscha, Somalia und Irak. Vollmanns übrige Werke beschäftigen sich oft mit Geschichten von Menschen am Rande des Krieges, der Armut und der Hoffnung. Viele Kritiker rühmen die Kühnheit und Originalität seiner Werke, die oft Techniken fiktiven und journalistischen Schreibens vermischen, wie auch sein immenses Wissen und die Schönheit seiner Prosa.
In deutscher Übersetzung ist das Buch unter dem Titel „Arme Leute“ bei Edition Suhrkamp erschienen.
In „Buch und Sofa“ haben wir bereits dieses Buch von Vollmann besprochen: „Kissing the Mask – Beauty, Understatemnet and Femininity in Japanese Noh Theatre“.