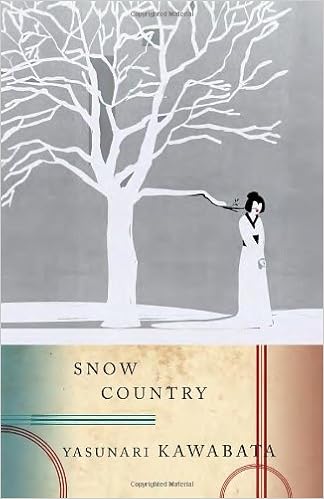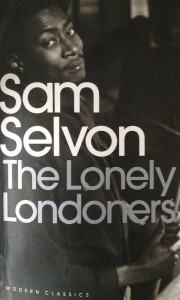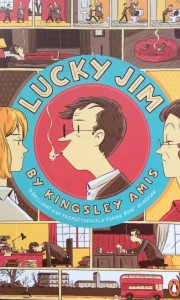Da ich sowieso gedanklich schon auf die Zeit um 1800 eingestellt war, fiel meine Wahl des nächsten Buchs auf „Goethe und Frau von Stein“ von Koopmann, erstmals erschienen 2002 – ein etwas leichterer Stoff, fern von Politik und Feldzügen.
Die große Liebe von Goethe und vielleicht die große Liebe von Charlotte von Stein ist Gegenstand von etwa 1700 Briefen, Billets, Notizen…, die Goethe in mehr als zwölf Jahren an sie schrieb. Die Briefe von Charlotte von Stein sind unzählig, da sie sie am Ende ihrer Liebe von Goethe zurückverlangt und Jahre später dann verbrannt hat. Hinzu kommt dieses Buch mit seinen 260 Seiten.
Das Buch, obwohl von einem Professor der Neueren Deutschen Literatur verfasst, ist nicht wissenschaftlich, sondern essayistisch geschrieben. Bei diesem essayistischen Schreiben scheint Koopmann sich strukturell und sogar sprachlich sehr an Goethe und dessen Briefen zu orientieren. Wie Goethe immer wieder auf unterschiedlichste Weise dasselbe an von Stein schreibt, variiert auch Koopmann immer wieder seine Darstellung derselben Beobachtungen, Analysen und Wahrnehmungen. Das hilft sehr, sich in die Beziehung hinein zu fühlen, zumal Koopmann dies mit Sensibilität tut. Es kann aber – wenn man denn nicht gerade wie Koopmann mitliebt – auch gelegentlich redundant wirken. Wissenschaftlich gesehen läuft Koopmann immer wieder Gefahr, zu vieles, was Goethe in seinen Briefen schreibt, prophetisch für spätere Lebensphasen zu halten, und alles, was Goethe sonst geschrieben und getan hat, vor allem aus seiner Liebesbeziehung zu Charlotte von Stein heraus zu interpretieren. Das Gras wächst mitunter recht laut.
Bei allen kritischen Anmerkungen in Summe ein gelungenes Buch, das man mit Gewinn flott lesen kann.
Als Leseprobe eine Partie zu dieser Zeichnung, die Goethe 1777 von Charlotte von Stein anfertigte:

„Das Entscheidende wird naturgemäß nicht sichtbar: ihre Augen, die es Goethe so sehr angetan haben. Man sieht es der Abgebildeten an, daß sie über dreißig Jahre alt ist, wenngleich es ein eigentümlich altersloses Porträt ist – Jugendlichkeit und Heiterkeit fehlen gänzlich, und von Lebenslust ist ebensowenig eine Spur zu erblicken. (…) Ein etwas verhärmtes Hofdamendasein, was sie dem Bild zufolge geführt haben mag, und sieht man sich dieses Porträt genauer an, versteht man, warum Goethes wildes Wesen sie (…) abstoßen mußte (…) Innere Disziplin und Zurückhaltung prägen dieses Antlitz, und man hat Mühe zu verstehen, warum Goethe sich so leidenschaftlich und so lange in sie verliebt hat.“