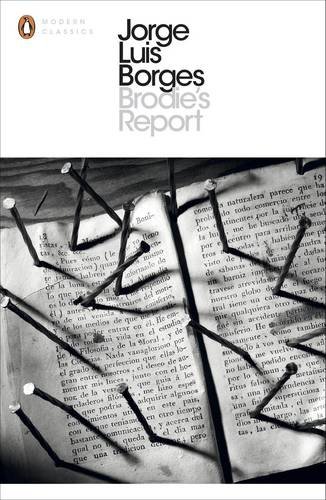Das Hauptwerk des irischen Finn-Zyklus – ein weiterer Beitrag zu einem obskuren, aber dadurch nicht weniger interessanten Werk der irischen Literatur.
Der Finn-Zyklus ist neben dem Ulster-Zyklus – zu dem die schon besprochene Táin Bó Cúailnge gehört – der zweite Hauptkreis von frühen, im Kern vorchristlichen Sagen Irlands. Im Mittelpunkt steht Finn mac Cumail, der eine Truppe von mehr oder weniger gesetzlosen Jäger-Kriegern, die Fianna (daher auch der Name einer politischen Partei Irlands, der Fianna Fáil) anführt, eine Art Robin Hood also. Finn hat – wie sich das für eine mythische Person gehört – übermenschliche Kräfte. So verfügt er auch über einen Zahn der Weisheit: Wenn man seinen Daumen daranhält, erschließt sich einem die Wirklichkeit. Um welchen Zahn im Gebiss es sich dabei handelt, ist allerdings – zum Leidwesen aller dontologisch Interessierten – leider nicht überliefert.

Zwei der Hauptbegleiter von Finn sind Oisín und Caílte mac Rónáin. Der erstgenannte mag den einen oder anderen Leser – und zwar völlig zurecht! – an Ossian erinnern, den Helden der Sagen des Nachdichters Macpherson.

So viel zum Drumherum.
Acallam na senórach, „Das Gespräch der alten Männer“, ist erstmalig in Handschriften von um 1200 überliefert. Keine der Handschriften – auch nicht die jüngeren aus dem 13. bis 16. Jahrhundert – macht recht glücklich, da der Text jeweils arg mitgenommen ist. Da muss man sich das Werk im guten Zustand halt vorstellen.
Oisín und Caílte mac Rónáin, die alten Männer des Titels, sind mittlerweile steinalt. Alle anderen Mitglieder der Fianna sind längst verstorben. Dafür ist das Christentum in Gestalt des heiligen Patrick eingetroffen. Womit wir die drei Hauptteilnehmer des titelgebenden Gesprächs beieinander haben.
Interessant ist der Text wegen seiner Struktur aus Rahmenhandlung – das Gespräch zwischen den drei Männern – und eingebetteten Geschichten aus der Blütezeit der Fianna. Interessant auch wegen dieser Geschichten selbst, die zum großen Teil sonst nirgends überliefert sind und auch wieder spätere Werke der irischen Literatur beeinflusst haben (zum Beispiel hat Flann O’Brien für seinen Roman „In Schwimmen-zwei-Vögel“ einen Ortsnamen verwendet, der hier zuerst erwähnt wird – dieses Buch wiederum hat James Joyce beeindruckt).

Vor allem fasziniert aber, wie in diesem Werk eine vorchristliche, also zutiefst heidnische Vergangenheit in das Christentum eingemeindet wird:
„There they were until the morrow’s morning came, when Patrick robed himself and emerged upon the green; together with his three score priests, three score psalmodists, and holy bishops three score as well, that with him disseminated faith and piety throughout Ireland. Patrick’s two guardian angels came to him now: Aibellan and Solusbrethach, of whom he enquired whether in God’s sight it were convenient for him to be listening to stories of the Fianna.“
Und so wird auch das Aufschreiben unzivilisierten Sagen zur guten christlichen Pflicht gemacht:
„‚Success and benediction!‘ said Patrick: ‚a good story it is that thou hast told us there; and where is Brogan the scribe?‘ Brogan answered: ‚here, holy Cleric.‘ ‚Be that tale written by thee‘; and Brogan performed it on the spot.“
So ähnlich wird jede Geschichte beendet, die von Caílte oder Oisín erzählt wird.
Bemerkenswert ist, wie weit entfernt die Gedankenwelt von unserer heutigen ist. Dies wird besonders frappierend, wenn es um Verwandtschaftsbeziehungen und Ortsnamen geht. Bezeichnungen von Orten waren den Kelten grundsätzlich sehr wichtig:
„Then Patrick set out, and the way that he took was into Feeguile; into Drumcree, which at this time is called ‚Kildare‘; across the sruithlinn in Durrow, and over the Barrow; over tOchar Leighe, i.e. ‘the stone causeway of Cuarneit’s daughter Liagh,’ where Liagh perished; into ‘the old Plain of Dian mac Dilenn’s daughter Roichet, now called ‘Moyrua of Rechet;’ into (….)” und so weiter über viele Zeilen.
Die Übersetzung von Standish Hayes O’Grady (1832-1915) stammt zwar aus dem Jahr 1892, ist aber ein echter Klassiker und vermittelt ein gutes Sprachgefühl des irischen Originals.