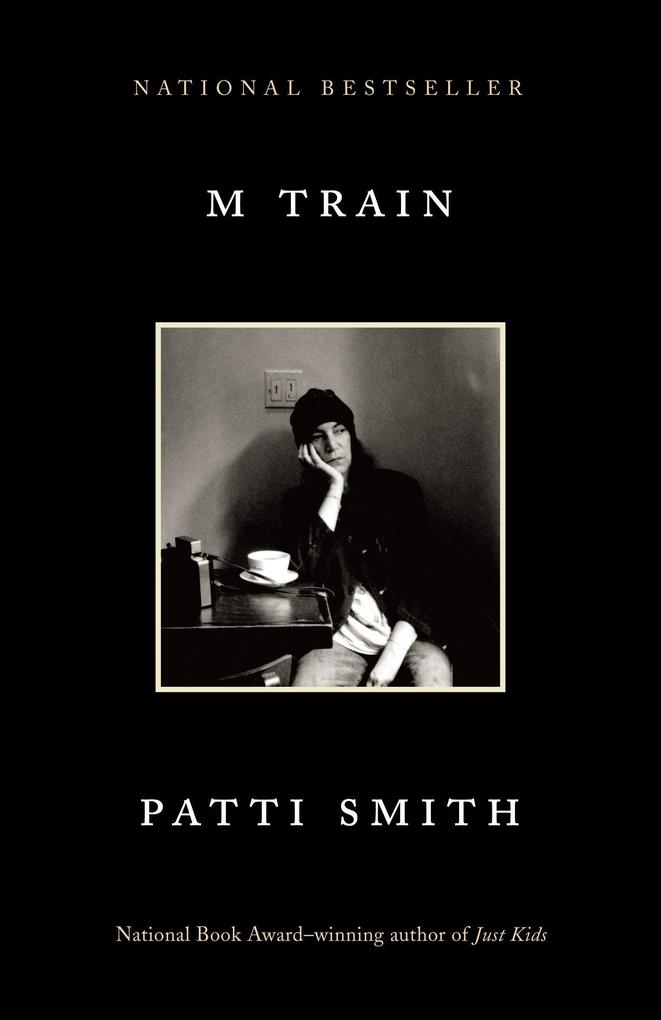Vergil!
Gefürchtet in Latein-Leistungskursen. Ein Star der Weltliteratur. Einflussreich überall in der westlichen Literatur, man denke nur an Vergil als Führer in Dantes Inferno. Die Bedeutung war so groß, dass Vergil es sogar zum Apotheker in Wales brachte. Wie es dazu kam, später in diesem Beitrag.

Zur Erinnerung:
Publius Vergilius Maro lebte von 70 – 19 vor unserer Zeitrechnung. Er war der staatstragende Dichter an sich unter Augustus. Bekannt ist er durch drei Werke: Die Georgica befassen sich mit Landwirtschaft. Die Eklogen sind bukolische Gedichte. In der Aeneis, seinem mit Abstand längsten Werk, schafft Vergil den Gründungsmythos Roms und wird Chefpropagandist von Augustus.
Für heute geeignet?
Sein Landwirtschaftswerk ist schon ein wenig sperrig. Aber die Aeneis ist spannend. Sie ist voller Abenteuer (Flucht aus dem brennenden Troja, Stürme, Schiffsbrüche!), Krieg (in Troja, in Italien…), Liebesgeschichten (Dido und Aeneas!). Sogar die Götter sind involviert (Juno ist gegen Aeneas).
Und das alles auf sprachlich hohem Niveau. Vergil wurde ja nicht als Propagandist berühmt, sondern als wirklich ausgezeichneter Schriftsteller!
Allerdings: Auf Hexameter muss man sich schon einlassen – der Sprachfluss im Deutschen ist nicht Prosa, sondern ein nervenzerrüttendes Ram-tata Ram-tata, egal ob das zur normalen Betonung der Worte passt oder nicht….
Im lateinischen Original ist das besser, hier wurden die Worte auch im Hexameter auf den Silben betont, die man auch beim normalen Sprechen betont hat. Der Hexameter richtet sich nach der Länge der Silben (Lang-kurzkurz….), nicht nach ihrer Betonung. Gelesen ergibt das eine wunderbare Spannung und einen beeindruckenden Rhythmus, der einen in den Bann ziehen kann, statt einen reif für eine Psychotherapie zu machen.
Ein Beispiel gleich vom Anfang, wo in Kürze dargestellt wird, worum es eigentlich geht:
„Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus Laviniaque venit
Litora, multum ille et terris iactatus et alto
Vi superum saevae memorem Iunonis ob iram,
Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem
Inferretque deos Latio, genus unde Latinum
Albanique patres atque altae moenia Romae.“
Auf deutsch, ohne Hexameter und Ram-tata:
Die Kämpfe und den Mann besinge ich, der als erster von Troja, durchs Schicksal ein Flüchtling, nach Italien kam und zur Küste Laviniums, viel über Lande geworfen und die hohe See durch die Gewalt der Götter wegen des nachtragenden Zorns der wütenden Iuno, viel auch im Krieg erleidend, bis er die Stadt (= Rom) gründete und die Götter nach Latium brachte, woher das latinische Geschlecht und die Väter Albas und die Mauern des hochragenden Roms (stammte).“
Zunächst einmal der Anspruch Vergils, der gleichzeitig auf Ilias („die Kämpfe“) und Odyssee („den Mann“, „Flüchtling“, „erleidend“) anspielt: Vergil als verdoppelter Homer. Dann der Inhalt: Es geht um eine noch nicht benannte Person, die als Kriegsflüchtling nach Italien kommt, um dort Rom zu gründen, zwischendrin alle möglichen Verwirrungen zu Lande und zu Wasser, auch erneut Krieg. Und das alles religiös aufgeladen: Die Götterwelt, vor allem Iuno, ist gegen ihn, aber es ihm vorbestimmt, Rom zu gründen und die eigenen Götter, die Götter Troias und seiner Ahnen, in Latium und Rom neu heimisch zu machen.
Alles kunstvoll verwoben in nur sieben Hexameter. Nicht schlecht als Anfang.
Erklärt aber nicht, wie Vergil zum Apotheker wurde.
Da eine von Vergils Eklogen schon im ersten oder zweiten Jahrhundert so gedeutet wurde, als habe er Christi Geburt vorhergesagt, wurden ihm auch passend magische Qualitäten zugesprochen. Ab dem 12. Jahrhundert wurde er in einigen Gegenden sogar weniger als Dichter, sondern hauptsächlich als Zauberer und Wahrsager rezipiert. Diese Tradition schwappte auch nach Wales. Dort heißt Vergil in einer von zwei Varianten „Fferyll“: „Roedd Publius Vergilius Maro, Fyrsil neu Fferyll yn Gymraeg“. Diese walisische Version seines Namens wurde erst ein Synonym für Zauberer/Magier/Wunderheiler allgemein und dann als „fferyllydd“ das heutige Wort für „Apotheker“. Quod erat demonstrandum!
Und welche Übersetzung der Aeneis bietet sich an?
Prosaübersetzungen sind mir nicht bekannt, also in deutschen Hexametern. Und dann am Besten die klassische Übertragung von Johann Heinrich Voß, auch wenn oder weil diese von um 1800 stammt (Goethe fand die Übersetzungen von Voß toll). Vielleicht etwas freier übersetzt als neuere Versuche, aber sprachlich erheblich beeindruckender und dadurch dichter am Original.
Oder natürlich im Original: Andere haben sich vor ein paar Hundert Jahren auch schon die Mühe gemacht!