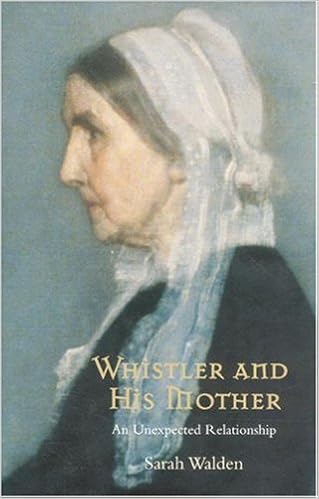Wie zwischenzeitlich fast jeder in Deutschland mitbekommen hat, feiert die Reformation in diesem Jahr einen runden Geburtstag, und zwar Nummer 500.
Diejenigen, die nicht in Thüringen wohnen und an denen dies bisher vorüberging, haben Ende Oktober die Chance, es auch noch zu merken: Auch in den anderen Bundesländern ist der Reformationstag dieses Mal gesetzlicher Feiertag. Über Martin Luther zu sprechen, ist also aktuell.
Das Buch, das ich heute bespreche, ist dagegen nicht mehr ganz taufrisch. Seine erste Auflage hat es bereits 2012 erlebt. Der Autor ist damit unverdächtig, aus dem Jubiläum Kapital schlagen zu wollen. Vielversprechend.

Gute Sachbücher kann man oft an der Anzahl der Auflagen erkennen. Vier bis zum Jubeljahr. Und die Jubel-Sonderausgabe 2017 auch schon in zweiter Auflage. Aktueller Amazon-Bestseller-Rang: Platz 5049. Sehr achtsam.
Der Autor Heinz Schilling ist ein Fachmann, Historiker mit kirchengeschichtlichen Interessen, zuletzt Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Ein Autor also, der weiß, wovon er schreibt. Sehr schön.
Das Drumherum des Buchs räumt also summa summarum die volle Punktzahl ab.
Und das Buch selbst?
644 Seiten. Die Schrift – Martin Luther profitierte ja von der neuen Möglichkeiten des Buchdrucks – in Schriftart und –größe gut lesbar.
Gut lesbar ist auch der Stil, den Schilling verwendet. Seine Sätze haben eine vernünftige, handhabbare Länge. Fremdworte kommen natürlich vor, aber er kommt auch ohne aus. Schilling muss nicht beweisen, dass er ein toller Wissenschaftler ist. Er möchte anscheinend lieber verstanden werden.
Das legt den Verdacht nahe, Schilling könnte vielleicht gerne die Dinge vereinfachen. Tut er aber nicht. Im Gegenteil, es ist Schilling offensichtlich ein großes Vergnügen, Sachverhalte in ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität zu betrachten und nuanciert verständlich zu machen. Große Historiker-Kunst, die er sehr gut beherrscht. Dies fand im Übrigen auch die FAZ in ihrer Rezension von 2012: „(…) der Autor zeigt, wie komplex damals das Feld der unterschiedlichen Kraftvektoren war, der Überlagerungen und überraschenden Verstärkungen, der konkurrierenden Persönlichkeiten, der Strukturen und religiösen Mentalitäten, die dann letztlich zu einem historischen Umbruch namens Reformation geführt haben.“
Damit ist es geradezu selbstverständlich, dass Schilling nicht nur Luthers Biographie, sondern auch seine Epoche beschreibt, politisch, kulturell, religionsgeschichtlich. Auch der Person Luthers gönnt er ihre Vielschichtigkeit, ihre Brüche.
Und da wird zum Beispiel sehr schnell deutlich, wie verwurzelt in der spätmittelalterlichen Kirche Luther gewesen ist. Ein Zitat:
„Wie seine Zeitgenossen war er davon überzeugt, dass sich das ewige Seelenheil durch aktive Leistungen des Menschen gewinnen ließe – durch gute Werke oder strenge, wie man meinte, gottgefällige Lebensweise in gebet, Buße, Selbstgeißelung. Mit seinem Eintritt ins Kloster vertraute auch er sich dieser verbreiteten Leistungsfrömmigkeit an. Indem er als Mönch wie kaum ein zweiter Leistung auf Leistung häufte und dennoch seines Heils nicht gewiss werden konnte, legte er selbst den Boden für jenen weltgeschichtlichen Paradigmenwechsel in der Anthropologie der Frömmigkeit, die von der mittelalterlichen Leistungs- zur Gnadenfrömmigkeit des neuzeitlichen Protestantismus führte.“
Und weiter: „… so war der Reformator Martin Luther zu Beginn seines religiösen Lebens nicht Kritiker, sondern besonders pflichtbewusstes Glied der spätmittelalterlichen Kirche. Ihre Leistungsfrömmigkeit und Heiligenverehrung war ihm ebenso wenig Stein des Anstoßes wie das Papsttum und die weit verästelte Hierarchie, über die der römische Pontifex in einem monarchistischen Absolutismus herrschte. Im Gegenteil, sein Problem war, dass er die vielen Leistungsangebote dieser Kirche besonders ernst nahm und daher umso tiefer verzweifelte, wenn sie ihm nicht die existentiell verlangte Errettung brachten und allenfalls wie Trostpflästerchen wirkten.“
Bemerkenswert, wie Schilling auch diplomatischen Finessen ins rechte Licht rückt. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, warum Luther trotz der Reichs-Acht, unter der er durch das Wormser Edikt stand – er war damit ja vogelfrei, quasi zum Abschuss freigegeben – nach seinem Aufenthalt auf der Wartburg in Sachsen so munter aktiv sein konnte.
Dazu Schilling: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zwischen der Habsburgerregierung und Kursachsen eine geheime oder doch stillschweigende Übereinkunft gab, das Äußerste zu verhindern. Jedenfalls wurde das Edikt dem sächsischen Kurfürsten nie offiziell zugestellt und besaß demzufolge in seinen Territorien keine Reichskraft.“
Und dann ist da noch die Sache mit den Namen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Luther das Wort „lutherisch“ nicht mochte, da er nicht zu einer Art Heiligem werden wollte. Schilling: „Seine Haltung ist emphatisch universell: ‚Ich bin und will kein Meister sein. Ich habe mit der Gemeinde die einzige, allgemeine Lehre Christi, der allein unser Meister ist.‘ Das war auch eine Abwehr gegen die bereits von Eck aufgebrachte abwertende Charakterisierung der evangelischen Bewegung als „lutherisch“, so wie die verwandte Vorgängerbewegung in Böhmen als „hussitisch“ deklassiert worden war. Die Vertreter der evangelischen Kirchen sind dem Reformator gefolgt und haben stets die Selbstbezeichnung als „Lutheraner“ abgelehnt – bis im Zuge der Konfessionalisierung in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die in der Konkordienformel 1577 geeinte Orthodoxie sich stolz „lutherisch“ nannte, um damit den Besitz der nunmehr gesicherten reinen Lehre des Reformators anzuzeigen.“
Und ich hatte nicht gewusst, dass Luther sich erst seit 1512 oder 1517 „Luther“ nannte. Vorher unterschrieb er immer als Martin Luder. Wobei ich vermute, dass sich an der Aussprache des Nachnamens im Kursächsischen dadurch nichts änderte.
Heißt alles in allem?
- Wer sich so ein dickes Buch zutraut,
- Wer sich für Luther und die Zeit der Reformation interessiert
- Nicht nur einfache Scherenschnitt-Meinungen schätzt
- Und gut schreibende Autoren mag
… liegt mit diesem Buch richtig.