100 Seiten zu den Ursachen moderner Morde. Ein knappes, kluges Buch. Es liest sich, als sei es ein Kommentar auf aktuelle Ereignisse in Syrien, in der Türkei, auf Terror-Anschläge in Europa. Ist es nicht … und ist es irgendwie doch.
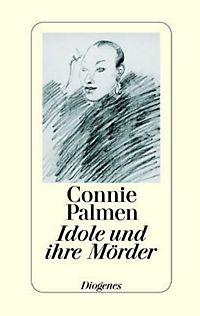
Der Einstieg: Palmen berichtet von einem Mann, der sie töten wollte. Aus Liebe. Es aber dann doch nicht tat und ihr statt dessen Champagner schickte.
Die Thesen: Palmen führt aus, wie ihrer Meinung nach die Mörder von Idolen/Berühmtheiten nicht mehr zwischen echt und unecht (Fiktion) unterscheiden können, zwischen öffentlichem Schein und Sein. Wesentlicher Grund hierfür sei die Einseitigkeit der Beziehung zwischen Berühmtheit und Fan: ökonomisch wechselseitig, ein gegenseitiges Geben und Nehmen, aber emotional einseitig. Der Fan wird von seinem Idol nicht als Individuum wahrgenommen. Das Idol bringt dem Fan im Krankheitsfall keine Gemüsebrühe ans Bett. Diese Einseitigkeit der emotionalen Beziehung bringt den Fan dazu, das Idol wie ein Symbol und eben nicht wie einen lebendigen Menschen wahrzunehmen.
Der Attentäter tötet in seiner Vorstellung keinen Menschen… „Für eine Philosophie des modernen Mordes muß man auf die Terminologie der Fiktion zurückgreifen. Mörder können ihre Opfer nicht als echte Personen sehen. In ihren Augen ermorden sie eine Figur aus ihrem idiosynkratischen Filmszenario, Theaterstück oder Roman, ein Symbol, eine Ikone. Alles, nur nicht einen leibhaftigen Menschen.“ Hierauf basiert inhaltlich auch der sehr viel treffendere Original-Titel „Iets wat niet bloeden kann“, Das, was nicht bluten kann.
Palmen führt aus, dass in ihren Augen die fanatische Verfolgung einer idealen Vorstellung vom richtigen Leben zur Verachtung anderer Menschen führen kann. Dies gelte für Glaubensfanatiker, Abstinenzler, Geizhälse und andere in gleicher Weise: „Die selbst auferlegten Beschränkungen und die daraus erwachsende einseitige Sichtweise treten an die Stelle des Denkens, der Reflexion, der Erinnerung, des Schmerzes, der Selbsterkenntnis und der Unterhaltung realer Beziehungen. (…) Der Fanatiker widmet sich einem Projekt oder Ziel nicht um dessen Bedeutung willen, sondern weil er sein eigenes Bedürfnis danach, sich mit etwas verbunden zu fühlen und sich dem völlig zu widmen, befriedigen möchte. Über seinen Fanatismus hinaus braucht der Fanatiker nichts und niemanden, um sich überlegen zu fühlen.“
In der Regel können besondere Situationen, in denen einer der beiden eine Rolle – öffentlicher Schein – spielt, gut verstanden werden, da sie sich in einem bestimmten, eng definierten Raum abspielen, so Palmen. Sie führt als Beispiele Psychiater, Nonnen, Huren und Schauspieler an. Als deren Produkte seelische Betreuung, Glaube, Sex und Spiel. In der modernen Medienkultur jedoch fehlt laut Palmen diese Form der räumlichen Abgrenzung: „Personen des öffentlichen Lebens unterhalten die gleiche Beziehung zur Gesellschaft wie der Psychiater, die Nonne, die Hure und der Schauspieler, nämlich eine ökonomisch wechelseitige und symbolisch einseitige. Auch sie tun dies ohne Ansehen der Person. Der Politiker, der Popstar, die Fernsehgröße, der Künstler und der Schriftsteller liefern ein Produkt gegen Bezahlung, und dieses Produkt ist an eine symbolische Persönlichkeit oder ein Image gekoppelt (…) Und weil definierende und schützende Grenzen fehlen, empfinden wir (sie) als vogelfrei.“
Bespiele für moderne Morde, die Palmen in ihrem Buch heranzieht, sind diejenigen von John F. Kennedy, John Lennon, Pim Fortuyn und Gianni Versace sowie die Attentate auf Andy Warhol und Ronald Reagan, ebenso die Selbsttötungen von Marilyn Monroe und Elvis Presley.
Das Buch ist 2004 in den Niederlanden erschienen. Gelesen habe ich die deutsche Übersetzung von Hanni Ehlers. Die Sprache kommt derart einfach daher, dass es fast passiert, den Grad der Komplexität bei den Inhalten zu übersehen.
Jedem Leser und jeder Leserin von Zeitungsartikeln und Büchern, die sich mit moderner Gewalt beschäftigen, sollte ihre Zeit für diese 100 Seiten von Connie Palmen nicht zu schade sein.

















